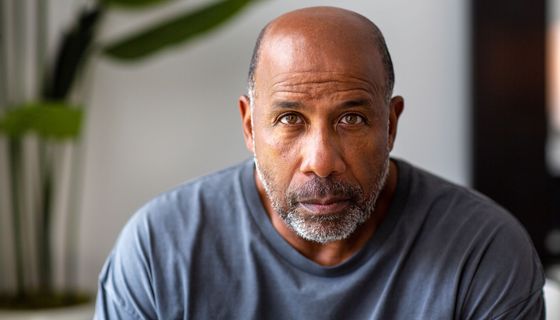- Apotheken-Notdienst
- Podcast
-
Podcast: "gecheckt!"
- Podcasts: Allergien
- Podcasts: Apotheke
- Podcasts: Arzneimittel
- Podcasts: Baby und Familie
- Podcasts: Diabetes
- Podcasts: Erkältung
- Podcasts: Ernährung
- Podcasts: Frauengesundheit
- Podcasts: Gesund leben
- Podcasts: Haut & Haare
- Podcasts: Magen-Darm
- Podcasts: Männergesundheit
- Podcasts: Medizin
- Podcasts: Naturheilkunde
- Podcasts: Psychologie
- Podcasts: Sport & Bewegung
- Podcasts: Zähne
- Podcast: Was ist das überhaupt?
- Newsletter
- Apotheke
- Medizin
- Naturheilkunde
- Ernährung
- Sport & Wellness
- Jung & Alt
- Frau & Mann
- Gesellschaft
- Service
- Gewinnspiel
- Das Apotheken Magazin
- Autoren
Darmkrebs-Früherkennung: Viele verzichten auf den kostenlosen Stuhltest
Ein einfacher Stuhltest kann Leben retten – doch in Deutschland nutzen nur wenige Menschen dieses Angebot zur Darmkrebsfrüherkennung. Könnten Erinnungsschreiben helfen? Ein Forschungsteam schlägt das vor.

© chameleonseye/iStockphoto
Ein Test auf Blut im Stuhl, das mit bloßem Auge nicht sichtbar ist, kann einen Hinweis auf Darmkrebs liefern. Er ist in wenigen Minuten durchgeführt, und die Kosten dafür tragen die Krankenkassen. Trotzdem nutzen in Deutschland weit weniger Menschen diese Chance auf Früherkennung als in Nachbarländern. Das hat eine Analyse der Daten einer großen Krankenkasse in Deutschland ergeben.
Drei Viertel der Männer haben keinen Stuhltest gemacht
Zwischen 2010 und 2022 haben nur 23 Prozent der Männer und 56 Prozent der Frauen im Alter von 50 bis 54 Jahren mindestens einen Test auf okkultes (verborgenes) Blut im Stuhl durchgeführt. Umgekehrt bedeutet das: Etwa drei Viertel der Männer und knapp die Hälfte der Frauen haben gar keinen Stuhltest gemacht.
Das Angebot einer großen deutschen Krankenkasse für einen jährlichen Test haben sogar nur 0,1 Prozent der Männer und knapp 2 Prozent der Frauen wahrgenommen. Zum Vergleich: In den Niederlanden oder England nutzen mehr als 70 Prozent der Berechtigten ein vergleichbares Angebot.
Eigeninitiative fehlt
Hermann Brenner vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg folgert aus den Zahlen: „Die bisherige, nicht organisierte und auf individueller Eigeninitiative beruhende Darmkrebsfrüherkennung erreicht große Teile der berechtigten Bevölkerung nicht. Gerade im Hinblick auf die nachgewiesene Wirksamkeit und Kosteneffizienz von Stuhltests zur Senkung von Darmkrebsinzidenz und -sterblichkeit besteht dringender Handlungsbedarf.“ Die Forschungsgruppe schlägt den Versand von Tests per Post und zielgerichtete Erinnerungsschreiben vor, um mehr Menschen zum Test zu ermutigen.
Darmkrebsfrühkennung: Was übernehmen die Krankenkassen?
Darmkrebs tritt bei älteren Menschen häufiger auf. Deshalb gibt es ein gesetzliches Früherkennungsprogramm für Menschen ab 50 Jahren, für das Krankenkassen die Kosten übernehmen:
- alle zwei Jahre ein Stuhltest oder
- zwei Darmspiegelungen im Abstand von zehn Jahren
Wer zehn Jahre nach der ersten Darmspiegelung keine weitere möchte, kann stattdessen auch Stuhltests machen.
Quelle: DOI 10.3238/arztebl.m2025.0102
Medikamente ohne Zuzahlung
Alle zwei Wochen neu: die aktuelle Liste der zuzahlungsfreien Arzneimittel.
Arzneimitteldatenbank
Medikamenten-Name oder Wirkstoff eingeben für mehr Informationen.
Podcast
Im Fokus diesmal: Neue Grenzwerte für Cannabis-Konsum, das Apothekensterben setzt sich unvermindert…
Aktuelle Nachrichten
aus Apotheke, Forschung und Gesundheitspolitik.
Krankheiten von A - Z
In diesem Lexikon finden Sie umfassende Beschreibungen von etwa 400 Krankheitsbildern