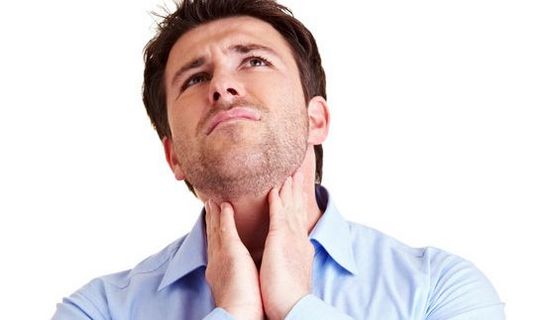- Apotheken-Notdienst
- Podcast
-
Podcast: "gecheckt!"
- Podcasts: Allergien
- Podcasts: Apotheke
- Podcasts: Arzneimittel
- Podcasts: Baby und Familie
- Podcasts: Diabetes
- Podcasts: Erkältung
- Podcasts: Ernährung
- Podcasts: Frauengesundheit
- Podcasts: Gesund leben
- Podcasts: Haut & Haare
- Podcasts: Magen-Darm
- Podcasts: Männergesundheit
- Podcasts: Medizin
- Podcasts: Naturheilkunde
- Podcasts: Psychologie
- Podcasts: Sport & Bewegung
- Podcasts: Zähne
- Podcast: Was ist das überhaupt?
- Newsletter
- Apotheke
- Medizin
- Naturheilkunde
- Ernährung
- Sport & Wellness
- Jung & Alt
- Frau & Mann
- Gesellschaft
- Service
- Gewinnspiel
- Das Apotheken Magazin
- Autoren
Pfeiffersches Drüsenfieber: Ursachen, Symptome und Behandlung
Halsschmerzen, Fieber, geschwollene Lymphknoten – das Pfeiffersche Drüsenfieber ist weit verbreitet, besonders bei Kindern und Jugendlichen. Hier erfahren Sie, wie sich die Erkrankung äußert, wie sie übertragen wird und welche Komplikationen auftreten können.

© PeopleImages/iStockphoto
Inhaltsverzeichnis
Überblick
Das Pfeiffersche Drüsenfieber, auch infektiöse Mononukleose genannt, ist eine häufige Virusinfektion, hervorgerufen durch das Epstein-Barr-Virus (EBV). Sie wird hauptsächlich über Kontakt mit Speichel übertragen, zum Beispiel beim Küssen. Die Krankheit verläuft meist mild, kann jedoch langwierig sein. In der Regel tritt sie im Kindes- oder jungen Erwachsenenalter auf. Nach der Ersterkrankung besteht meist eine lebenslange Immunität.
Symptome Pfeiffersches Drüsenfieber
Die Symptome des Pfeifferschen Drüsenfiebers ähneln zunächst denen einer Grippe oder Angina:
- Halsschmerzen, geschwollene Mandeln mit weißlichen Belägen
- Fieber (oft über mehrere Tage anhaltend)
- Ausgeprägte Müdigkeit, Abgeschlagenheit
- Lymphknotenschwellungen (Hals, Achseln, Leisten)
- Kopfschmerzen, Gliederschmerzen
- Appetitlosigkeit
- Leber- und Milzvergrößerung (Palpationsschmerz linker Oberbauch)
- Hautausschlag (besonders bei Gabe von Penicillin)
Die Beschwerden können mehrere Wochen andauern. Die ausgeprägte Erschöpfung ist oft das dominierende Symptom – selbst nach Abklingen der Infektion. Bei kleinen Kindern sind die Symptome oft milder oder unspezifisch. Manchmal äußert sich die Erkrankung lediglich durch Fieber und allgemeine Abgeschlagenheit. Dadurch bleibt eine Infektion häufig unerkannt.
Verlauf
In der Regel verläuft das Pfeiffersche Drüsenfieber mild und klingt innerhalb von 2-4 Wochen ab. Symptome wie Müdigkeit und Erschöpfung können noch einige Zeit weiterbestehen. In seltenen Fällen, insbesondere bei Menschen mit einem stark geschwächten Immunsystem, können Komplikationen auftreten.
Mögliche Komplikationen:
- Die Vergrößerung der Milz ist ein häufiger Befund, weswegen in der akuten Phase unbedingt auf körperliche Anstrengung verzichtet werden sollte (Risiko für Milzriss).
- Bei etwa 10 Prozent der an Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankten Menschen kommt es zu einer zusätzlichen Infektion mit Streptokokken, die mit Antibiotika behandelt wird.
- Zu den sehr seltenen, aber ernsten Komplikationen gehören eine Hirnhaut- oder Herzmuskelentzündung sowie eine Nieren- und Leberentzündung.
- Eine Infektion kann zur Entstehung bestimmter Krebserkrankungen beitragen – zum Beispiel des Hodgkin-Lymphoms.
- Reaktivierung: Das Epstein-Barr-Virus bleibt lebenslang im Körper und kann bei geschwächtem Immunsystem wieder aktiv werden. Die Erkrankung verläuft dann meist ohne Symptome, ist aber ansteckend.
Ursachen von Pfeifferschem Drüsenfieber
Das Pfeiffersche Drüsenfieber wird durch das Epstein-Barr-Virus aus der Gruppe der Herpesviren verursacht. Das Virus wird hauptsächlich über Speichelkontakt übertragen, etwa beim Küssen oder über gemeinsam genutztes Besteck und Trinkgefäße. Es befällt zunächst die Schleimhautzellen im Nasen-Rachen-Raum und später die weißen Blutkörperchen, die es in Lymphknoten, Milz und Leber transportieren können. In seltenen Fällen kann das Virus während der Schwangerschaft über die Plazenta auf das ungeborene Kind übertragen werden.
Diagnose
Erste Anhaltspunkte über das Vorliegen von Pfeifferschem Drüsenfieber ergeben sich aus den typischen Symptomen. Für die Bestätigung der Diagnose sind folgende Tests üblich:
Blutuntersuchungen
- Blutbild: Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen (Leukozytose) und atypische Lymphozyten („Drüsenfieberzellen“).
- Leberwerte: Oft leicht erhöht bei Leberbeteiligung.
Spezielle Tests
- Monospot-Test: Schnelltest auf Antikörper, vor allem bei Jugendlichen zuverlässig.
- EBV-Antikörpernachweis: Detaillierter Test auf spezifische Antikörper, um eine frische oder frühere Infektion nachzuweisen.
- Differenzialdiagnose: Ausschluss anderer Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen, z. B. bakterielle Mandelentzündung, da eine unnötige Antibiotikagabe – insbesondere Penicillin – zu Hautausschlägen führen kann.
- Bildgebung: Bei Verdacht auf Milz- oder Leberbeteiligung kann eine Ultraschalluntersuchung sinnvoll sein.
Behandlung: So wird Pfeiffersches Drüsenfieber therapiert
Eine ursächliche Therapie gegen das EBV gibt es nicht. Die Behandlung erfolgt symptomatisch und zielt auf die Linderung der Beschwerden sowie die Vorbeugung von Komplikationen ab.
Empfohlene Maßnahmen:
- Schonung und ausreichend Schlaf – wichtig zur Unterstützung des Immunsystems
- Fiebersenkende Mittel (z. B. Paracetamol oder Ibuprofen) bei hohem Fieber
- Viel trinken, sowie leichte, vitaminreiche Kost
- Gurgellösungen oder Lutschtabletten zur Linderung der Halsschmerzen
- Verzicht auf körperliche Belastung, insbesondere Sport, für mindestens vier Wochen
Wichtig: Auch nach Abklingen der Symptome sollte körperliche Aktivität nur langsam gesteigert werden, da die Milz noch lange vergrößert bleiben kann. Eine Milzruptur zählt zu den gefährlichsten, wenn auch seltenen Komplikationen.
Was die Apotheke rät
- Schonung und Ruhe: Körperliche Anstrengung vermeiden, um die Heilung zu unterstützen und das Risiko von Komplikationen (z.B. Milzriss) zu senken.
- Flüssigkeitszufuhr und Ernährung: Viel trinken, leichte und nährstoffreiche Kost bevorzugen, um das Immunsystem zu unterstützen.
- Medikamentenverträglichkeit beachten: Einige Antibiotika (z.B. Penicillin) können bei Pfeifferschem Drüsenfieber Hautausschläge auslösen.
- Immunsystem stärken: Pflanzliche Stimulanzien (z. B. Echinacea, Zink, Vitamin C) können das Immunsystem zusätzlich unterstützen
Kurz zusammengefasst
- Pfeiffersches Drüsenfieber wird durch das Epstein-Barr-Virus ausgelöst, die Übertragung erfolgt über Speichelkontakt („Kusskrankheit“).
- Symptome: Halsschmerzen, Fieber, Lymphknotenschwellung, starke Müdigkeit.
- Bei Menschen mit gesundem Immunsystem verläuft die Infektion meist harmlos und heilt ohne Folgen aus. Manchmal kann sie aber zu länger anhaltender Erschöpfung führen.
- Ruhe und Schonung sind entscheidend. Um Komplikationen vorzubeugen, sollte man für mindestens 4 bis 6 Wochen auf körperliche Aktivitäten und Sport verzichten.
- Für Menschen mit einem stark geschwächten Immunsystem kann die Infektion gefährlich sein. Sie sollten den engen Kontakt zu infizierten Menschen meiden.
zuletzt aktualisiert: 27.10.2025
Hier geht es zum Gesundheitslexikon mit allen Krankheiten von A-Z!
Medikamente ohne Zuzahlung
Alle zwei Wochen neu: die aktuelle Liste der zuzahlungsfreien Arzneimittel.
Arzneimitteldatenbank
Medikamenten-Name oder Wirkstoff eingeben für mehr Informationen.
Podcast
Im Fokus diesmal: Warum ein kurzfristiger Einsatz von Abnehmspritzen Geldverschwendung ist,…
Aktuelle Nachrichten
aus Apotheke, Forschung und Gesundheitspolitik.
Krankheiten von A - Z
In diesem Lexikon finden Sie umfassende Beschreibungen von etwa 400 Krankheitsbildern